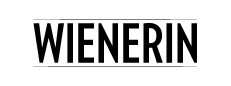Brooklyn Beckham, David Beckham und Victoria Beckham bei den Fashion Awards 2018 in der Royal Albert Hall in London. © Shutterstock
Was haben Leni Klum, Lily Collins, Brooklyn Beckham und Hailey Bieber gemeinsam? Nein, es ist nicht nur ihr gutes Aussehen oder ihre Instagram-Follower:innenzahl. Sie alle sind Teil der sogenannten „Nepo-Babys“, die das Internet seit einiger Zeit ordentlich aufmischen.
Geboren im Scheinwerferlicht
„She has her mother’s eyes. And her agent“, titelte das New York Magazine Ende letzten Jahres. Dazu: eine Galerie junger Hollywood-Stars, die in die Glamour-Welt hineingeboren wurden. Kein Casting nötig – der Zugang zu Bühne, Kamera oder Laufsteg war für sie von Geburt an geöffnet.

Vitamin B statt Bewerbung
„Nepo“ steht für „Nepotismus“, also Vetternwirtschaft, gepaart mit dem niedlich klingenden „Baby“ – einer Bezeichnung für Menschen, die von den Beziehungen ihrer prominenten Eltern profitieren. Ob in der Modebranche, im Film, in der Musik oder beim Opernball – diese Kids haben es einfacher. Und das sorgt, besonders auf TikTok, für Zündstoff. Ein prominentes Beispiel dafür ist Leni Klum, Tochter von Heidi Klum. Als sie auf dem Wiener Opernball posierte, fragten sich viele: Hat sie sich diesen Moment erarbeitet – oder hat ihre prominente Mutter das Türchen geöffnet? Die Kommentarspalten waren voll mit skeptischen Stimmen, viele davon mit einem klaren Urteil: Ohne Heidi hätte es Leni nicht bis zum Red Carpet geschafft.

Privilegien? Ja. Talent? Vielleicht.
Jetzt mal ehrlich: Natürlich kann ein berühmter Nachname Türen öffnen. Aber die Frage ist, was passiert, wenn man durch eine dieser Türen geht. Denn Talent, Charisma und harte Arbeit sind damit nicht automatisch gegeben. Die Kritik an Nepo-Babys ist selten purer Neid, sondern oft Ausdruck eines größeren Problems: ungerechte Chancenverteilung. Denn in einer Welt, in der viele Menschen hart für ihre Träume schuften und trotzdem an geschlossenen Türen scheitern, wirkt es fast zynisch, wenn jemand mit minimaler Anstrengung und maximaler Vitamin-B-Dosis auf Magazincovern landet.

Nope statt Nepo
Doch zwischen all den Glamour-Nepo-Kids blitzen auch immer mehr Nope-Babys hervor – der rebellische Gegenentwurf. Während Nepo-Babys das Rampenlicht oft direkt von Mama und Papa übernehmen, sagen Nope-Babys: „Nein, danke.“ Ein Nope-Baby ist ebenfalls Kind berühmter Eltern – nur entscheidet es sich, sich lautstark von ihnen zu distanzieren. Vivian Jenna Wilson, Tochter von Elon Musk, etwa. Sie ist trans und wurde vom eigenen Vater praktisch für „tot“ erklärt – wie Musk in einer offen transfeindlichen Aussage behauptete. Vivians Reaktion auf TikTok: „Ich verspreche, ich bin nicht tot.“
Heute trägt sie den Nachnamen ihrer Mutter – und wird zur Stimme gegen Big Tech, Patriarchat und Transfeindlichkeit. Auch Lisa Brennan-Jobs, die in ihren Memoiren ein ehrliches und schmerzhaftes Bild ihres Vaters Steve Jobs zeichnete, verweigerte sich dem Promistatus der Apple-Legende. Und Ronan Farrow, Sohn von Mia Farrow und Woody Allen, stellte sich nicht nur gegen seinen Vater, sondern entlarvte auch mit seinen #MeToo-Recherchen Machtmissbrauch in der Unterhaltungsindustrie. All diese Nope-Babys nutzen ihre Herkunft nicht für Werbedeals, sondern für Kritik und Aufklärung.

Doppelte Standards
Die Diskussion rund um Nepo- und Nope-Babys ist nicht nur eine über Privilegien, sondern auch eine geschlechterpolitische. Denn während männliche Nepo-Babys wie Brooklyn Beckham oft mit einem Achselzucken hingenommen werden („Jo, halt der Sohn von David“), stehen weibliche Promi-Kids unter ganz anderem Druck: Sie sollen nicht nur schön und berühmt, sondern am besten noch bescheiden und super sympathisch sein. Leni Klum wird nicht nur gefragt, wie sie dorthin gekommen ist – sondern oft auch, ob sie überhaupt das Recht dazu hat. Spoiler: Diese Frage wird männlichen Nepo-Babys weit seltener gestellt.
Mehr „Nope“ bitte!
Nepo-Babys per se zu verteufeln, bringt wenig – es geht nicht ums Canceln, sondern um Transparenz. Privilegien zu benennen, statt sie zu verstecken, wäre ein Anfang. Ein ehrliches „Ja, ich hatte Hilfe“ wirkt oft sympathischer als das Mantra vom harten Alleingang. Vielleicht sollten wir also öfter über die sprechen, die laut „Nope“ sagen. Nicht, weil sie moralisch überlegen sind, sondern weil sie Mut zeigen: zum Abgrenzen und zum Schreiben eigener Kapitel. Sie nutzen ihre Plattform nicht zum Vererben von Macht, sondern zum Hinterfragen von Strukturen. Denn am Ende geht es nicht um berühmte Nachnamen. Sondern darum, was man daraus macht – oder eben nicht macht.
Mehr zur Autorin:

Tjara-Marie Boine ist Redakteurin für die Ressorts Business, Leben und Kultur. Ihr Herz schlägt für Katzen, Kaffee und Kuchen. Sie ist ein echter Bücherwurm und die erste Ansprechpartnerin im Team, wenn es um Themen wie Feminismus und Gleichberechtigung geht.