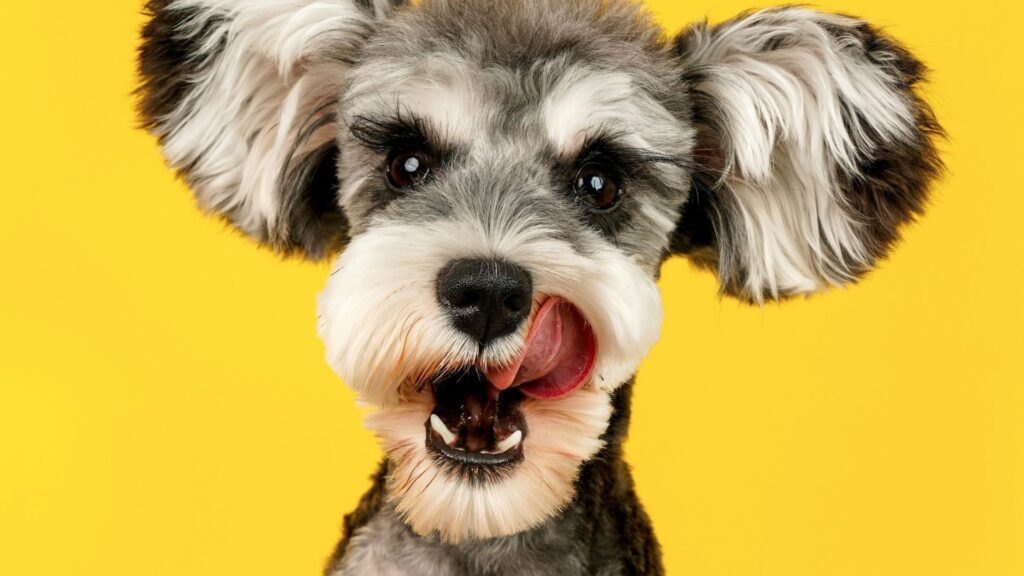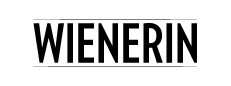© Pexels/ Valery
Laut dem aktuellen Weltdrogenbericht wächst der Kokainkonsum rasant – auch in Österreich durchdringt die Substanz alle Gesellschaftsschichten. Was Kokain „kann“, welche Risiken und Gefahren es birgt, beschreiben
„Betroffene“ und Expert:innen.
“Echt?! Du hast es noch nie probiert?“, lacht sie. Ich schüttle den Kopf und bemühe mich, cool zu wirken. Die Frage trifft mich unvorbereitet, und für einen Augenblick überlege ich, ob ich mich rechtfertigen soll. Die Frage stellt eine liebe Freundin, und das Gespräch umweht nicht mehr Exotik, als ginge es um eine trendige Enthaarungsmethode oder Heuschrecken als Proteinsnack. Dabei geht es um Kokain. „Fährst du Snowboard?“ – so lautet beispielsweise eine zweideutige Frage, ein proaktives Angebot in der Gastroszene, wird mir später Marina Jung im Interview erzählen.
Wacher. Aktiver. Selbstbewusster.
„Du merkst, wie dein Herz anfängt schneller zu schlagen, wie deine Sinne geschärft werden, der Bass knallt härter, du willst tanzen. Dir ist egal, wie die anderen Leute über dich denken, du bist gut drauf, du kannst mit den Leuten quatschen“, erzählt Rolf L. von seiner ersten Line in einer Disco (im True-Crime-Podcast „Lubi – Ein Polizist stürzt ab“).
Wie ein sechsfacher Orgasmus. „Die Welt um dich verschwindet. Die Stimmen und Geräusche gehen weit weg. (…) Dann denkst du, das ist das, was ich will, genau das und nur das“, schrieb Benedict, Marina Jungs Sohn.
In ihrem Buch berichtet sie auch von einem zweifachen Vater und Wissenschaftler, der mit Kokain Nächte durcharbeitet. Und von einer erfolgreichen Gastronomin, die unter sozialen Ängsten leidet und bei größeren Events Kokain konsumiert, „um locker und ungezwungen auf die Gäste zugehen zu können”.
Viele der häufig genannten positiven Effekte klingen „verlockend“. Verlockend genug, um Risiken und Gefahren in Kauf zu nehmen – und auszublenden, dass der Konsum von Kokain in Österreich illegal und der Besitz strafbar ist? Und überhaupt: Wieso scheint Kokain aktuell so allgegenwärtig zu sein? Gibt es gerade ein Comeback?
„Es war überhaupt nie weg“, sagt Daniel Lichtenegger, Leiter des Büros für Suchtmittelkriminalität im Bundeskriminalamt. „Kokain galt aber lange als teure Droge für die High Society, durch die niedrigeren Preise ist es in den vergangenen Jahren in die Fläche gegangen.“ Ein Gramm kostet auf dem Schwarzmarkt zwischen 50 und 150 Euro, die Menge reicht für mindestens zehn Lines.
Kokain durchdringt alle Gesellschafts- und Altersschichten
Laut dem jüngsten Weltdrogenbericht stieg die Zahl der Konsument:innen innerhalb von zehn Jahren von 17 auf 25 Millionen, Europol spricht von einem „historischen Höchststand der weltweiten Kokainproduktion“ (2025). „Es wäre aber zu einfach zu sagen: Es wird mehr produziert, daher wird mehr konsumiert“, betont Daniel Lichtenegger. Sein Team sei jedenfalls aktuell mit Drogenkriminalität konfrontiert, deren Strukturen einerseits laufend „professioneller“ und andererseits brutaler werden. Straff durchgetakteten „Geschäftsprozessen“, wobei mitunter jede Taxirechnung in die Buchhaltung kommt und der Gärtner für Cannabis-Plantagen ein fixes Einkommen erhält, stehen skrupellose Sanktionen durch rivalisierende Kokain-Clans gegenüber. Menschen werden Körperteile abgeschnitten, sie werden gefoltert oder ermordet. „Wo es eine Verbindung zum Drogenhandel gibt, ist Gewaltkriminalität allgegenwärtig“, weiß Lichtenegger.
Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er in der Suchtmittelbekämpfung, „den gesamten Krieg gegen Drogen werden wir nie gewinnen, aber er muss geführt werden. Wenn es auch pathetisch klingt: Uns geht es darum, die Bevölkerung zu schützen. Als Ermittler im Suchtgiftbereich braucht man jedenfalls auch diese intrinsische Motivation.“
Die rasante digitale Entwicklung läutete in der Drogenkriminalität eine neue Ära ein; seit 2015 wird das Darknet intensiv für den Handel genutzt, seit geraumer Zeit vermehrt Social-Media-Kanäle und Messenger-Dienste. „Du kannst 24/7 und 365 Tage im Jahr Drogen bestellen, es wird frei Haus geliefert“, weiß Lichtenegger. Es gibt eigene Plattformen, über die bestellt werden kann, inklusive Rezensionen zu Lieferung und Qualität. Das erklärte Ziel ist und bleibt: die Täterstrukturen auszudünnen und dabei möglichst potente Köpfe zu fassen; unlängst wurde über einen Drogenboss in Österreich sogar lebenslange Haft verhängt. Die speziell für den Kampf gegen Drogen zusammengesetzte Arbeitsgemeinschaft „Achilles“ hat derzeit mehrere Tausend Personen im Drogen-Mafia-Milieu mit Bezug zu Österreich im Visier.
Kokain-Erfahrungen
Bei den Sicherstellungen steht Kokain – nach Cannabis – an zweiter Stelle. Ein Kokain-Rausch hält für gewöhnlich rund eine halbe Stunde. Was passiert abseits dieser Zeit? Auf der Suche nach Antworten fand ich „Kokainjahre“ der Schweizerin Marina Jung, aus dem hier bereits zitiert wurde. Das Sachbuch basiert auf einer tragischen Lebensgeschichte: Benedict, der Sohn der Autorin starb 2020, er war erst 26 Jahre alt – und kokainabhängig. Dem Buch sei eine intensive Recherchearbeit vorausgegangen, die sie zunächst für sich selbst als Teil des Trauerprozesses betrieben habe, sagt sie im Interview. „Ich wollte verstehen, wie es möglich ist, dass ein junger Mensch so schnell in Abhängigkeit geraten kann. Ich habe angefangen, alles zu lesen, zu hören und zu sammeln, was ich zu Sucht und Kokain auftreiben konnte. Dabei realisierte ich, wie naiv wir waren. Wir hatten nicht das Wissen, das wir gebraucht hätten, um einen adäquaten Umgang mit dem Substanzkonsum unseres Sohnes zu finden.“
Ihr gesammeltes Fach- und Erfahrungswissen soll heute anderen eine Hilfe bieten, über dem Buch stehe die zentrale Erkenntnis: „Sucht ist weder eine Charakter- noch eine Willensschwäche, es ist eine Krankheit“, sagt sie. Die Autorin integriert unter anderem auch Originaltexte aus Benedicts Nachlass. „Ich habe lange überlegt, ob ich die Geschichte meines Sohnes erzählen, seine Texte drucken darf. Sie sind extrem berührend, ausdrucksstark und erlauben einen Perspektivenwechsel, um sich in die Lebensrealität eines suchtkranken Menschen hineinzuversetzen.“
Ein weiteres Zitat von ihm: „Mit diesen Zeilen möchte ich mich immer wieder daran erinnern, dass sich ein Konsum, in welcher Form auch immer, nicht lohnt. Das Elend kommt schneller, als die Vorfreude dauert. Und am Ende? Du bist alleine, verzweifelt, körperlich und seelisch erschöpft, ohne Hoffnung.“
Benedict studierte, machte Sport und hatte eine Freundin. „Wir haben nichts gemerkt. Der Kokainkonsum steht einer Person lange nicht ins Gesicht geschrieben“, sagt Marina Jung. „Als er eines Tages sagte, dass er ein Problem habe, war er bereits abhängig.“ Zu den Fallbeispielen, die sie beschreibt, zählt auch ein erfolgreicher Unternehmer und dreifacher Vater. Mit 50 stirbt er unter der Dusche an Herzversagen – nach zehn Jahren kostenintensiven Kokainkonsums. Um die Existenz der Familie zu sichern, muss seine Witwe das Haus verkaufen.
Benedict habe Kokain aus Neugier versucht, „aber er hat schnell ein Substanzgedächtnis gebildet und rasch eine Abhängigkeit entwickelt“, sagt Marina Jung. „Ein suchtkrankes Kind zu haben, ist brutal. Trotzdem gab es auch schöne Momente, die bis heute nährend sind, und abstinente Phasen, die Anlass zur Hoffnung gaben. Hoffnung wird in solchen Situationen zu einer Kraft, die enorm trägt.“
Benedict ist gerade acht Wochen lang clean und arbeitet an Projekten im Ausland, als ein Telefonat erneut Marina Jungs Sorge um ihn akut werden lässt. Sie klammert sich an seine Worte, sich auf Weihnachten zu freuen. Nach einer WhatsApp-Nachricht ist er nicht mehr erreichbar, einen Tag nach der Vermisstenanzeige überbringen ihr zwei Polizisten die Todesnachricht von ihrem Sohn. Er hatte einen folgenschweren Rückfall. „Ich bin immer noch nicht in der Lage, die ganze Dimension dieser Tragödie zu erfassen, und das ist wahrscheinlich gut so. Wenn ich das könnte, könnte ich sie nicht ertragen“, sagt Marina Jung.
Wie entsteht Abhängigkeit? Wie wirkt Kokain überhaupt?
„Die Substanzwirkung hängt von mehreren Faktoren ab“, erklärt Bettina Hölblinger, Bereichsleiterin der Suchtprävention der Suchthilfe Wien. Die Faktoren sind: die konsumierende Person (Set), das Umfeld bzw. der Rahmen, in dem konsumiert wird (Setting), und die Substanz selbst. Sie können beruhigend, aufputschend oder halluzinogen wirken, und es gibt Mischkombinationen. Durch Kokain werden die Botenstoffe Noradrenalin und Dopamin nicht so schnell abgebaut, sie bleiben quasi länger aktiv, „das führt dazu, dass die Person wacher, aktiver und selbstbewusster wird. Bei jeder positiv erlebten Substanzwirkung ist aber auch mit negativen Effekten zu rechnen. Neben einer starken Herz-Kreislaufbelastung durch Kokain kann der Rausch auch Angst- und Panikattacken und im schlimmsten Fall eine kokaininduzierte Psychose auslösen.“
„Es gibt keine Substanz, von der man nach einmaligem Konsum abhängig wird“, stellt Bettina Hölblinger klar. Man durchlaufe sozusagen verschiedene Phasen. Die erste ist der Probierkonsum. Am Beispiel eines jungen Menschen und seiner ersten Erfahrungen mit Alkohol heißt das: Er ist ungefähr so lange im Probierkonsum, bis er weiß, wie er sich fühlt, wenn er beispielsweise zwei Bier trinkt, bis er also die Wirkung abschätzen kann. Die nächste Phase ist der Gelegenheitskonsum: die bewusste Entscheidung, bei ein paar Events Alkohol zu konsumieren. „Man kann sich das wie einen Korridor mit verschiedenen Türen vorstellen, wo man rein- und wieder rausgehen kann. Jetzt denken wir Set und Setting dazu: Wenn ein Mensch feststellt, dass es ihm nicht gut geht, und es geht ihm besser, wenn er Alkohol oder eine andere Substanz konsumiert, und er verwendet diese psychoaktive Substanz immer dafür, um ein schlechtes Gefühl besser zu machen, geht er schon in Richtung Selbstmedikation oder missbräuchliches Konsummuster“, erklärt Bettina Hölblinger. Man könne diese Tür noch verlassen, aber die Schwierigkeit liege darin, wenn man keine anderen Ressourcen oder Lösungsstrategien etwa für ein schlechtes Gefühl parat hat. Je öfter die „Lösung“ im Substanzkonsum gesucht wird, desto mehr rutsche man schließlich in Richtung einer Substanzgebrauchsstörung, also in eine Abhängigkeit, hinein.
Kokain birgt einen heimtückischen „Spezialeffekt“: „Es flutet sehr schnell an, aber die Wirkung lässt sehr schnell, schon nach 30 bis 45 Minuten nach. Das Risiko dabei ist, dass man viel mehr konsumiert, weil man jeweils sehr schnell wieder ,nachlegt‘.“ Zu den zahlreichen Gefahren zähle außerdem, dass man nicht wisse, was drinnen ist, handelt es sich doch um ein Produkt vom Schwarzmarkt. Um dieses Risiko zu minimieren, bietet das Wiener Kompetenzzentrum für Freizeitdrogen „checkit!“ Drug Checking an – inklusive anonymer und kostenloser Beratung vor Ort und online. Manche Menschen suchen schon „früh“ Rat, weil sie eine Substanz öfter konsumieren, als sie das möchten, andere merken, dass sie ihre finanzielle Situation nicht mehr im Griff haben oder dass Beziehung oder Job unter ihrem Substanzkonsum leidet, zählt Bettina Hölblinger auf.
„Die Substanz steht für uns als Berater:innen nicht an erster Stelle, sondern die Motivation, warum eine Person etwas konsumiert und was sie verändern möchte. Alle Substanzen haben eine positive, aber auch eine negative Wirkung – selbst Schokolade. Da kommt es auch darauf an: Esse ich jeden Tag eine 300-Gramm-Tafel oder gelegentlich eine? – Natürlich muss man bei illegalisierten Substanzen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen mitbedenken. Das bedeutet oft: Die Menschen wenden sich später an Betreuungsangebote, weil es viel schambehafteter ist.“
Zu dieser Erkenntnis kam auch Marina Jung, die mit ihrem Buch ursprünglich Angehörige adressierte. „Ich wünsche mir, dass betroffene Familien den Mut haben, sich Hilfe zu suchen, dass sie sich vernetzen, ihr Schicksal nicht allein tragen und ihre Scham überwinden, die mit Suchtkranken in der Familie einhergeht.“ Als sie vor wenigen Monaten „Kokainjahre“ veröffentlichte, wussten sie und der Verlag Rüffer & Rub, dass es sich zwar um ein wichtiges Buch, aber um ein Thema handelt, auf das die Gesellschaft ungern sieht. Und doch avanciert „Kokainjahre“ in kurzer Zeit zum Bestseller in der Schweiz, und die Autorin erhält laufend eine Vielzahl an positiven Feedbacks. Dazu gehören Briefe von Angehörigen, aber ebenso von Betroffenen.
„Besonders freut mich auch, wenn mir Menschen ohne Bezug zu Sucht schreiben, sie würden Suchtkranke jetzt in einem anderen Licht sehen. Kürzlich habe ich einen Brief von einem hohen Polizeichef erhalten, der das Buch seinen Ermittler:innen empfiehlt, damit sie den Perspektivenwechsel vollziehen. All das ist überwältigend, und so habe ich das Gefühl, ich konnte einen kleinen Beitrag zur Entstigmatisierung leisten.“
Info & Beratung: checkit.wien