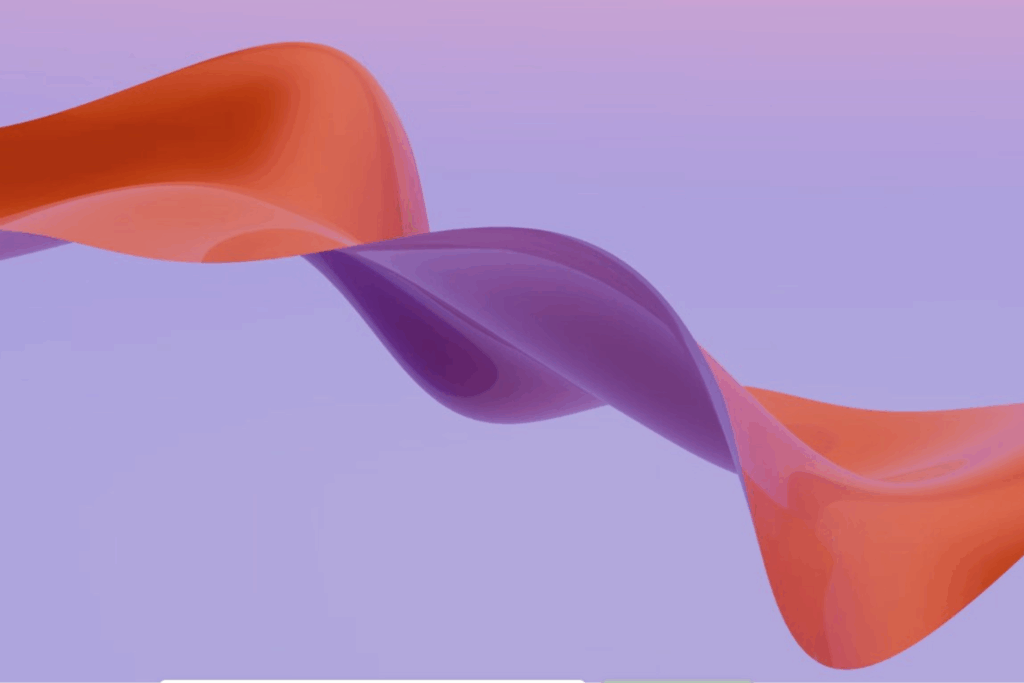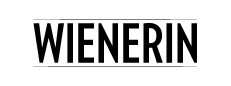Cybergewalt: Hundekamera is watching you
Was bedeutet Cybergewalt heute? Welche Formen gibt es – und was kann man dagegen tun?
© Shutterstock
Habt ihr Ebo verwendet?“, fragt sie, bückt sich und trägt die fahrende Haustierkamera ins Vorzimmer auf ihre Ladestation. Die Kinder schütteln den Kopf und sie waren es auch am Tag danach nicht. Es vergeht eine Woche, sie hat Homeoffice und ist gerade in Arbeitsunterlagen vertieft, da schaltet sich ohne Aufforderung der smarte Lautsprecher ein.
Sie zuckt zusammen – er spielt einen Song, der sofort Erinnerungen weckt. Sie blickt sich irritiert im menschenleeren Wohnzimmer um und schaltet das Gerät wieder ab. Wenige Tage später wiederholt sich die Situation, die Woche darauf ebenso.
Soll ich das deinem Chef schicken?
Dann kommt eine Whatsapp mit einem Urlaubsfoto, aus „glücklicheren“ Zeiten in einem Hotelzimmer. Darunter steht: „Na, soll ich das deinem Chef schicken?“ Sie will einer Freundin davon berichten und verabredet sich mit ihr in einem Café – doch ehe sie sie erblickt, sieht sie ihn dort. „Wieso ist er da? Ein Zufall?“, fragt sie sich. Ein kalter Schauer läuft ihr über den Rücken.
Die Trennung war hart genug. Es vergehen noch viele Monate, bis sich die schlaflosen Nächte wieder zu häufen beginnen und sie die Nummer vom Gewaltschutzzentrum wählt. Es ist nicht das erste Mal. „Ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube, er überwacht mich“, sagt sie. „Und vielleicht verfolgt er mich auch.“

Unser Ziel ist, die Sicherheit der Opfer zu erhöhen, damit sie wieder selbstbestimmter werden.
Nina Wallner, Opferschutzexpertin
Zu Social Media und Messengerdiensten kam in jüngster Vergangenheit eine Vielzahl neuer „Tools“ hinzu, die für Cybergewalt zweckentfremdet werden. Die Einleitung dieses Artikels enthält einen bedrohlichen Mix aus Dingen, die Opfer erleben. Und doch ist es nur ein kleiner Ausschnitt. Cybergewalt ist mittlerweile ein großer Brocken in der Arbeit der Gewaltschutzzentren. „Wir verstehen darunter alle Gewalthandlungen, die im digitalen Raum stattfinden oder die sich technischer Hilfsmittel bzw. digitaler Medien bedienen.
Sie werden missbraucht, um Kontrolle auszuüben, unter Druck zu setzen, zu überwachen, zu diffamieren“, zählt Nina Wallner vom Gewaltschutzzentrum Burgenland auf. Sie ist Sozialarbeiterin, Mediatorin und Trainerin zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Mädchen und Frauen und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Gewaltprävention und Opferschutz.
Kontrollverlust
Cybergewalt tritt in der Regel nicht isoliert auf; Betroffene erleben zumeist auch andere Formen, also beispielsweise physische, sexualisierte oder psychische Gewalt. „Was Cybergewalt so belastend macht, ist, dass sie orts- und zeitunabhängig stattfinden kann. Während eine Person irgendwo sitzt und sich sicher fühlt, kann in derselben Sekunde im Netz eine Beleidigung gegen sie stattfinden oder sie überwacht werden.
Das sorgt für Ohnmacht, Kontrollverlust und Hilflosigkeit“, erklärt Nina Wallner. Sie legt Betroffenen ans Herz, sich Unterstützung zu holen, um sich gemeinsam mit Expert*innen auf Spurensuche zu begeben, sich einen Überblick zu verschaffen und individuelle Sicherheitsmaßnahmen zu treffen und gegebenenfalls rechtliche Schritte zu setzen.
„Die wichtigste Botschaft: Niemand muss das allein durchstehen.“ Das Gewaltschutzzentrum Burgenland berät kostenlos und vertraulich bei Gewalt bzw. Cybergewalt im sozialen Nahraum, wenn also die Gefährder*innen aus dem familiären Umfeld kommen oder es sich um Partner*innen oder Ex-Partneri*nnen handelt. Das Geschlechterverhältnis ist dabei wie bei anderen Formen von Gewalt: Der Großteil der Opfer sind weiblich, der Großteil der Gefährder*innen männlich. Betroffene gibt es in allen Generationen, von der Schülerin bis hin zur Pensionistin.

Varianten von Cybergewalt
„Zu häufigen Formen gehören Belästigen und Kontrolle durch Anrufe und Nachrichten, Diffamierungen via Social Media und Whatsapp-Gruppen“, beschreibt Nina Wallner. Eine perfide Strategie von Gefährdern sei die sogenannte bildbasierte sexualisierte Gewalt. „Sie drohen damit, frühere, eventuell im Einvernehmen entstandene Intimfotos zu veröffentlichen, an Arbeitgeber und Familie zu schicken.
Das wird oft als Druckmittel vor oder im Rahmen einer Trennung verwendet und ist natürlich sehr schambesetzt“, weiß die Opferschutzexpertin. Es kommt auch vor, dass das Opfer das Bild- oder Videomaterial gar nicht kennt, weil Kameras heimlich in der Wohnung angebracht wurden.
Was IOT und smarte Geräte können
Es braucht aber kein besonders gutes technisches Können, um Cybergewalt auszuüben, mittlerweile kann eine Vielzahl an Geräten missbräuchlich verwendet werden. Das genderspezifische Problem: Laut aktuellen Studien wird weiterhin der Großteil an technischem Equipment für den Haushalt von Männern angeschafft und installiert.
„Häufig wissen die anderen Bewohner*innen gar nicht, dass beispielsweise der Staubsaugerroboter eine integrierte Kamera hat oder was der smarte Lautsprecher im Wohnzimmer alles kann“, gibt Nina Wallner zu bedenken.
Der sogenannte IOT-Bereich, kurz für Internet of Things, also Alltagsgegenstände, die mit dem Internet verbunden sind, und smarte Geräte erleben eine rasante Entwicklung. Während es freilich ein Vorteil sein kann, mittels eines smarten Türschlosses das Kind, das früher von der Schule heimkehrt, vom Büro aus ins Haus zu lassen oder den Wasserverbrauch via App zu checken, kann umgekehrt ein Gefährder kontrollieren, wann jemand das Haus betritt oder verlässt, wie viele Personen an einem Tag duschen oder wie oft die Klospülung betätigt wurde.
Machtdemonstration
Männer kennen häufig auch die Handycodes ihrer Partnerinnen. „Das öffnet Tür und Tor: Es kann beispielsweise eine Stalkerware am Smartphone installiert werden, die eine umfassende Überwachung ermöglicht. Der Gefährder kann damit Telefonate abhören, Nachrichten lesen, jedes Bild, jedes Video anschauen oder beliebig den Lautsprecher aktivieren“, zählt die Opferschutzberaterin auf.
„Oftmals passieren Überwachungen aus strategischen Gründen, um Druckmittel zu sammeln“, weiß Nina Wallner. „Oder um Psychoterror auszuüben, selbst wenn bereits ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen wurde. Zumeist geht es den Gefährdern um Kontrolle und Machtdemonstration. Das passiert auch in aufrechten Beziehungen.“ Klient*innen berichten etwa davon, dass sie permanent ihren Standort teilen müssen, auch unter Androhung von physischer Gewalt, andere werden in einer Trennungssituation Opfer von pausenloser Überwachung.
Es braucht eine Sensibilisierung für die digitale Privatsphäre, das gilt auch für Passwörter.
Nina Wallner, Opferschutzberaterin
Dabei gehe es auch oft darum, Angst zu machen, mit dem Ziel, die Partnerin dazu zu bringen, in der Beziehung zu bleiben. Besonders heimtückisch an Cybergewalt ist, dass die Gefährder teilweise scheinbar spurlos agieren können. „Manche Frauen haben einen Verdachtsmoment, manchmal ein diffuses Gefühl, sie würden überwacht“, beschreibt Nina Wallner. „Das gilt es ernst zu nehmen. Würde es beispielsweise als psychisches oder psychiatrisches Problem eingestuft, wäre die Gefahr groß, dass Cybergewalt nicht erkannt wird.“
Sie richtig einordnen zu können, bedürfe laufender Sensibilisierung und Schulung von Berater*innen, aber ebenso von Polizei und Justiz, betont die Opferschutzexpertin. Cybergewalt kann genauso zu lebensbedrohlichen Situationen führen wie andere Formen von Gewalt. Zum einen gelte es, sich zu vergegenwärtigen, wie gefährlich ein Gefährder sein kann, wenn er dermaßen viel Zeit in Überwachung steckt. Zum anderen können die massive Ohnmacht und Hilflosigkeit Betroffene in schwere psychische Krisen bis hin zur Suizidgefährdung bringen.
Bündel an Maßnahmen
Allgemeingültige Ratschläge geben Gewaltschutzzentren bei Cybergewalt nicht heraus. „Schutz und Sicherheit der Opfer gehen immer vor, wir analysieren jede Situation individuell. Denn während es beispielsweise in einem Fall helfen kann, ein Passwort zu ändern, könnte das in einem anderen zur folgenschweren Verstärkung der Gewalt gegen das Opfer führen“, warnt Nina Wallner.
In Kooperation mit einem IT-Experten bieten die Gewaltschutzzentren Betroffenen einen vertraulichen kostenlosen Smartphone-Check an. „Unser Ziel ist, mit einem Bündel an Maßnahmen aus psychosozialer, rechtlicher und Sicherheitsberatung die Sicherheit von Frauen zu erhöhen, damit sie wieder ermächtigter und selbstbestimmter werden“.
Mit einem präventiven Tipp möchte sich die Opferschutzberaterin an die Menschen wenden: „Es braucht ein Umdenken, eine Sensibilisierung für die digitale Privatsphäre, das gilt auch für Passwörter. In keiner gesunden Beziehung darf es Überwachung und Kontrolle geben.“
Gewaltschutzzentrum Burgenland
Kostenlose und vertrauliche Beratung, Smartphone-Check
Tel.: 03352/31 420
office.bgld@gewaltschutzzentrum.at
www.gewaltschutzzentrum.at/burgenland/
Das könnte dich auch noch interessieren:
Weitere Artikel zu diesem Thema
Lifestyle
8 Min.
Cortisol ist nicht der Feind
Warum Cortisol unseren Alltag steuert und wie wir lernen, im richtigen Rhythmus zu leben.
Fühlt man sich oft gestresst, müde oder gereizt, kann das viele Ursachen haben. Eine davon: ein Cortisolspiegel im Ungleichgewicht. Mit diesen fünf Tricks habe ich mein Cortisol gesenkt!“ – „So bringst du dein Stresshormon runter!“ – „In nur einer Woche bin ich mein Cortisol-Face losgeworden!“ So oder so ähnlich beginnen viele Videos, die auf TikTok … Continued
8 Min.
Mehr zu Lifestyle