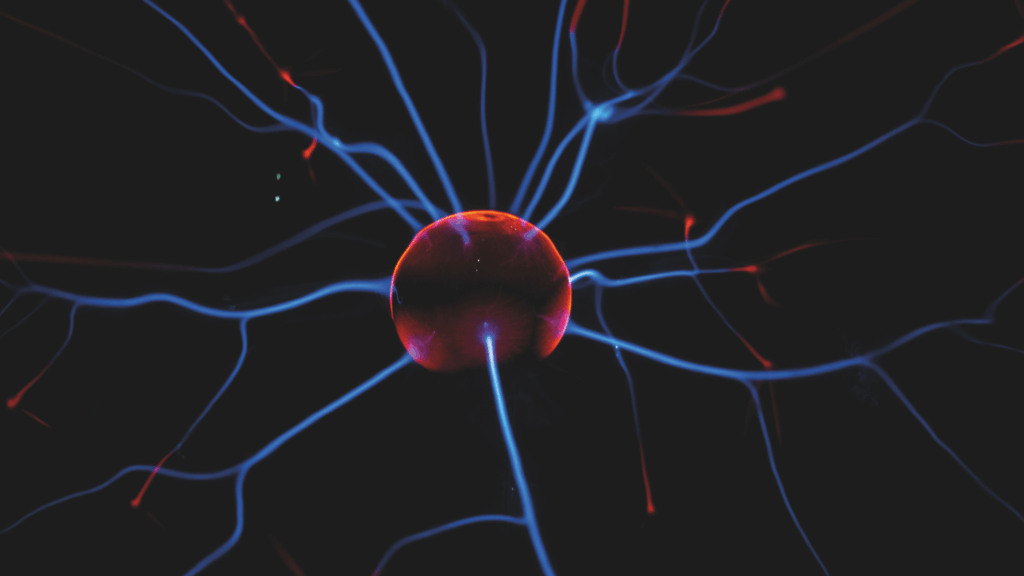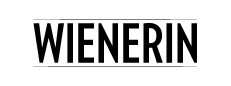© Shutterstock
Von künstlicher Intelligenz, die die Musikbranche umkrempelt und Menschlichkeit, die sich nicht programmieren lässt.
Würdest du den Unterschied hören, wenn ein Song nicht von einem Menschen, sondern von einer Maschine komponiert, produziert und sogar gesungen wurde? Eine Frage, die nicht nur die Kreativindustrie, sondern auch die breite Öffentlichkeit zunehmend beschäftigt – und auch mir ist sie in letzter Zeit immer wieder durch den Kopf gegangen. Der aktuelle Anlass? The Velvet Sundown. Eine KI-Band, die es gar nicht gibt und trotzdem millionenfach gestreamt wird.
Aus Neugier spielte ich Personen in meinem Umfeld ein paar ihrer Songs vor, ohne zu verraten, worum es geht. Die Reaktionen? Schulterzucken, zustimmendes Nicken, ein beiläufiges „Klingt gut.“ Keine Spur von Irritation. Wie nah KI-generierte Musik inzwischen an das „Echte“ heranreicht, zeigte auch ein Abend Ende Mai im legendären Wiener Club U4 – einst Bühne für Falco, Nirvana und Pionier:innen der 80er- und 90er-Jahre-Undergroundszene. Anstatt altbekannter Party-Klassiker standen diesmal eigens KI-generierte Songs auf dem Programm, die für überraschte Gesichter und Aha-Momente auf dem Dancefloor sorgten.
Maschine oder Mensch?
Für Hannes Tschürtz, Produzent und Gründer des österreichischen Indie-Labels „Ink Music“, ist diese Entwicklung keine Überraschung. „Die Digitalisierung hat die Musikproduktion in eine völlig neue Dimension katapultiert“, sagt er. Was früher als kreative Vision galt, könne heute automatisiert werden. Dabei perfektioniere KI vor allem „den Hang zum Durchschnitt“. Der Wunsch nach makellosen, playlisttauglichen Songs führe dazu, dass das Einzigartige manchmal verloren gehe.
Diese Beobachtung teilt auch Emanuel Lobaza, Head Instructor im Fachbereich Audio am SAE Institute Wien. Für ihn ist die KI-Entwicklung weniger ein Bruch als eine logische Fortsetzung dessen, was Sampling und Remixes längst vorgemacht hätten: eine Aufweichung der Grenze zwischen Original und Kopie. Nun mache die Maschine den nächsten radikalen Schritt und komponiere komplett selbst.
Binnen Sekunden entstehen Tracks, die klingen, als wären sie für den nächsten Spotify-Hit gemacht.
Florian Madner, KI-Experte
Was bedeutet das konkret im Alltag von Produzent:innen, Musikschaffenden und letztlich auch für Hörer:innen? Florian Madner, Universitätsassistent am Institut für Digitale Transformation und Künstliche Intelligenz der Sigmund Freud Privatuniversität, beschäftigt sich intensiv mit KI-generierten Medieninhalten sowie deren rechtlichen und gesellschaftlichen Fragen. Seine Forschung holt er dabei bewusst aus dem akademischen Elfenbeinturm in die Praxis, etwa mit Veranstaltungen wie zuletzt im U4, bei der die Besucher:innen im Rahmen eines interaktiven Quiz erraten mussten, ob ein Song von einer Maschine oder einem Menschen stammt.
„Wir möchten Menschen für das Thema KI in der Musik sensibilisieren, nicht nur theoretisch, sondern unmittelbar und erlebbar.“ Er unterscheidet zwei Arten von KI-Nutzung in der Musik: Zum einen Tools, die bei der Nachbearbeitung und dem Feinschliff eines Songs helfen – eine große Hilfe, besonders für junge Acts mit kleinem Budget. Zum anderen generative KI, die Songs eigenständig komponiert, produziert und interpretiert. „Binnen Sekunden entstehen da Tracks, die klingen, als wären sie für den nächsten Spotify-Hit gemacht“, so der KI-Experte. Ein Studio braucht es dafür nicht mehr. Ein Smartphone reicht. Das Ergebnis? Effizienz ohne Ende.

Aber auch eine neue Herausforderung für Künstler:innen, deren Werke plötzlich mit perfekten, algorithmisch gestylten Sounds konkurrieren müssen. Während viele Nachwuchs-Acts mühsam um Aufmerksamkeit ringen, gehen KI-Projekte wie The Velvet Sundown viral, mit Berichten in Feuilletons und Diskussionen in der Presse. Für die österreichische Musikerin TEYA ist das längst keine abstrakte Entwicklung mehr, sondern bittere Realität. „Ich habe schon Jobs verloren an KI.“ Früher nahm sie Vocals für DJs auf – heute lassen viele Produzent:innen künstliche Stimmen singen. Es geht schneller, kostet weniger und klingt oft täuschend echt. „Das ist wirklich gruselig“, sagt die Mitautorin des ESC-Siegerhits 2025.
KI-Musik mit Stimmen aus dem Jenseits
Besonders brisant wird es, wenn KI nicht nur neue Songs erschafft, sondern Stimmen Verstorbener täuschend echt nachahmt. Auf Spotify tauchten zuletzt plötzlich Titel auf den offiziellen Profilen von Countrymusikern wie Blaze Foley oder Guy Clark auf, obwohl beide seit Jahren tot sind. Die Stücke klangen verblüffend authentisch, waren aber komplett KI-generiert. Weder Familien noch Rechteinhaber:innen hatten zugestimmt, eine Kennzeichnung gab es nicht. Erst nach öffentlicher Kritik wurden die Songs entfernt. Für den Wissenschaftler Florian Madner ein ethisch besonders heikles Thema: „Wenn musikalisches Erbe zum Spielplatz von Algorithmen wird, brauchen wir klare Regeln.“
Aber auch in anderen Bereichen der Musikproduktion fehle es an klaren rechtlichen Grenzen, und die Möglichkeiten, eigene Rechte durchzusetzen, seien oft unzureichend. Madner betont, dass eine der größten Herausforderungen im Umgang mit KI in der Musik die Irreführung der Hörer:innen sei. Wenn diese nicht mehr erkennen könnten, ob ein Song von einem Menschen oder einer Maschine stammt, werde damit das Vertrauen untergraben. Diese Problematik zeigt sich auch in der Praxis: Immer wieder tauchen in den letzten Monaten auf Plattformen wie TikTok vermeintlich neue Songs von Künstler:innen wie etwa Justin Bieber oder Cro auf, die sich später als KI-generierte Produktionen entpuppen.
Vorfälle, die deutlich machen, wie leicht KI die Musikgeschichte verfälschen oder Karrieren manipulieren kann und wie unvorbereitet Streamingplattformen und soziale Netzwerke darauf reagieren. Ob es um das Erbe Verstorbener geht oder um aktuelle Künstler:innen – KI stellt uns vor die dringende Aufgabe, für mehr Transparenz und klare Spielregeln zu sorgen. Doch genau dies fehlt bislang.
Bis wir einem KI-Avatar im Stadion zujubeln, wird es hoffentlich noch dauern.
Hannes Tschürtz, Produzent und Musiklabel-Gründer
Erst im August 2026 tritt die neue EU-Verordnung über künstliche Intelligenz in Kraft. Sie soll sicherstellen, dass KI in Europa vertrauenswürdig und rechtskonform eingesetzt wird, auch im Kreativbereich. Doch viele rechtliche und ethische Fragen bleiben offen. Florian Madner nennt es ein „Hinterherhinken der Regulierung“, das bei einer so dynamischen Entwicklung kaum zu vermeiden sei. KI entwickle sich in Echtzeit weiter und stelle Gesetzgeber:innen und Gesellschaft vor immer neue Herausforderungen.
Dennoch dürfe man die Entwicklungen nicht einfach passieren lassen. Madner fordert daher: „Was wir brauchen, sind Regeln mit Augenmaß. Keine schnellen Verbote, sondern ein klarer Rahmen, der Innovation fördert und gleichzeitig sicherstellt, dass menschliche Kreativität nicht auf der Strecke bleibt.“
Zurück zur Substanz
In einem Punkt sind sich alle Gesprächspartner:innen einig: Das Live-Erlebnis wird sich nicht einfach automatisieren lassen. „Viele Musiker:innen kopieren heute, was stark gehört wird – aber genau das wird KI besonders schnell lernen“, sagt Singer-Songwriter Stephan Sommerbauer (Zug nach Wien). Für ihn ergibt sich daraus eine paradoxe Chance: Wer sich abheben will, muss wieder mutiger, individueller und handwerklich präziser werden. Der Wiener Musiker spricht sogar von einer möglichen „Professionalisierung“ der Szene – hin zu mehr Substanz, Ausbildung und Eigenständigkeit.

Auch Tonspezialist Emanuel Lobaza interpretiert die Entwicklung eher als Katalysator denn als Gefahr. Gerade die Menschlichkeit in der Performance, kleine Ungenauigkeiten oder die Magie zwischenmenschlicher Momente – all das fehlt der Maschine. Und genau darin, so Lobaza, liege der Reiz des Echten. Musik sei mehr als die Summe ihrer Noten: „Ein Computer wird niemals dieselben Gefühle in uns hervorrufen können wie die Chemie zwischen zwei Menschen.“ Produzent Hannes Tschürtz bringt es schließlich pragmatisch auf den Punkt: KI mag für „Fahrstuhlmusik“ bzw. Gebrauchsmusik im weitesten Sinne eine Rolle spielen – „aber bis wir einem KI-Avatar im Stadion zujubeln, wird es hoffentlich noch ein bisschen dauern.“
KI-Musik als Türöffner
Trotz aller Skepsis überwiegt bei vielen die Hoffnung, dass KI nicht verdrängt, sondern unterstützt. Emanuel Lobaza betont die Chance für Künstler:innen, sich stärker auf jene Aspekte zu konzentrieren, in denen Individualität und Kommunikation weiterhin glänzen. Denn viele mühsame, technische Arbeitsschritte könnten bald automatisiert ablaufen. „So bleibt mehr Raum für das, was wirklich zählt“, sagt er.
Auch Florian Madner sieht in dieser Entwicklung eine demokratisierende Dimension. Er verweist darauf, dass Musikproduktion über Jahrzehnte hinweg oft mit hohen finanziellen Hürden verbunden war. „Heute können erstmals Menschen kreativ arbeiten, die bisher keinen Zugang hatten – unabhängig von musikalischer Vorbildung oder Budget.“ KI ersetze keine Ideen, aber sie senke die Schwelle, sie hörbar zu machen. Gerade für Stimmen aus sozialen Schichten, die bisher wenig Zugang zur Musikproduktion hatten, eröffne sich dadurch eine neue Bühne.
Die Musikbranche steht an einem Wendepunkt. Zwischen Euphorie und Skepsis, zwischen Automatisierung und Authentizität. Der technologische Wandel ist nicht aufzuhalten, wohl aber gestaltbar. Dabei müssen wir uns fragen: Wie bewahren wir die Einzigartigkeit menschlicher Kreativität? Wo ziehen wir die Grenze zwischen Inspiration und Manipulation durch KI? Und wie garantieren wir, dass Musiker:innen auch in Zukunft Gehör finden?
„KI ist kein Ersatz für menschliche Kreativität, sondern ein Werkzeug, das sie beflügeln kann. Vorausgesetzt, wir stellen die richtigen Fragen. Und hören genau hin“, hält Florian Madner treffend fest. Denn am Ende lebt Musik von echten Emotionen und von der Authentizität, die nur Menschen schaffen können.
© Hersteller
DAS KÖNNTE DICH AUCH INTERESSIEREN
- Wie TikTok die Musikindustrie verändert – und was das für Künstler:innen bedeutet
- So klingt Gleichberechtigung: Spotify-Chefin Conny Zhang im Interview
- Beth Ditto: „Wir Queers und Weirdos waren schon immer da“
MEHR ÜBER DIE REDAKTEURIN:

Als Redakteurin der WIENERIN erkundet Laura Altenhofer gerne die neuesten Hotspots der Stadt. Besonders angetan hat es ihr jedoch die vielfältige Musikszene Wiens. Ob intime Clubkonzerte oder große Festivalbühnen – man findet sie meist dort, wo die Musik spielt.
Weitere Artikel zu diesem Thema
Lifestyle
4 Min.
Die Arbeitswelt von morgen: 5 Bereiche, die zeigen, wohin die Reise gehen könnte
Work in Progress: Neue Technologien, flexible Strukturen und veränderte Erwartungen sorgen dafür, dass die Arbeitswelt von morgen neu gedacht und gelebt wird.
1. Arbeitszeiten Die starre Einteilung in klassische Bürozeiten wird zunehmend abgelöst – nicht, weil jüngere Generationen weniger leisten wollen, sondern weil Studien zeigen: Flexibilität steigert Produktivität, Zufriedenheit und Effizienz. Wer entscheiden kann, wann er am besten arbeitet, bringt oft mehr Leistung – und bleibt gesünder. Flexible Zeitmodelle gelten längst nicht mehr als Benefit, sondern als … Continued
4 Min.
Mehr zu Lifestyle