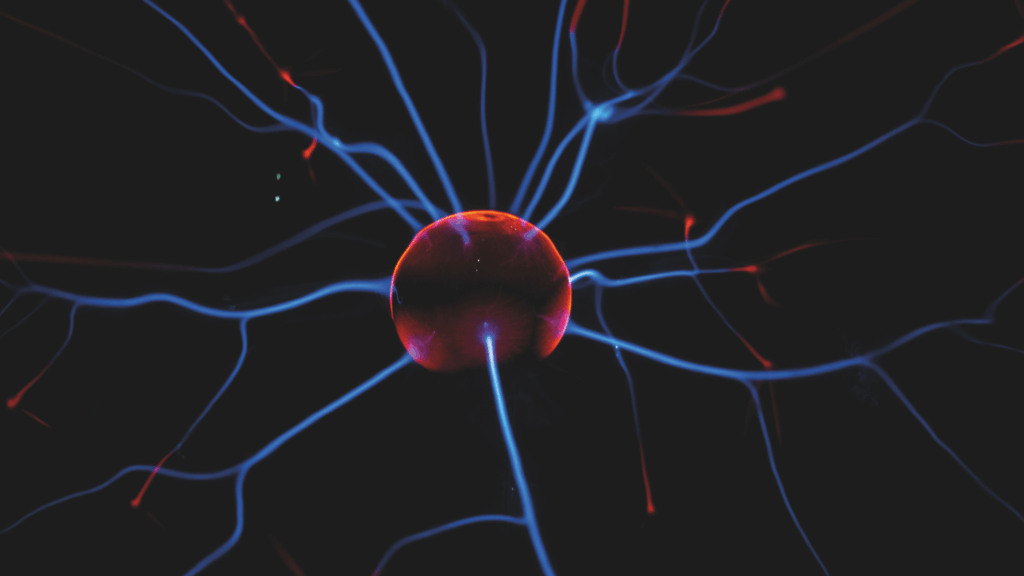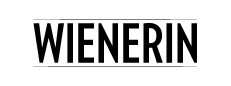© Shutterstock
Demenz verändert das Leben enorm, auch für Angehörige. Über den Kampf gegen das Vergessen – und neue Ansätze, die Hoffnung machen.
Jeden Donnerstag isst Susanne mit ihrer Enkelin Judith zu Mittag. Um zwölf Uhr, immer im selben Gasthaus. Irgendwann merkt Judith, dass sich etwas verändert: Susanne kommt immer öfter zu spät, sie verwechselt den Tag oder vergisst das Mittagessen überhaupt. Judith fallen auch noch andere Dinge auf: dass ihre Oma immer öfter die gleiche Kleidung trägt, Arzttermine seltener wahrnimmt oder sich manchmal nicht mehr daran erinnern kann, was Judith ihr beim letzten Mal erzählt hat.
Steigende Zahlen
Susanne hat Demenz – und sie ist damit nicht allein. Etwa 100.000 Österreicher:innen leiden aktuell an der Erkrankung, 2025 wird diese Zahl voraussichtlich auf etwa 168.000 angestiegen sein. Wie kann man Betroffene und Angehörige bestmöglich unterstützen?
Wir sprechen mit Josef Marksteiner, ärztlicher Leiter der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie A am LKH Hall, und Verena Bramböck, Leiterin der Koordinationsstelle Demenz des LIV Tirol.

Was passiert bei Demenz genau im Hirn?
Josef Marksteiner: Prinzipiell gibt es zwei Hauptursachen für Demenz. Die erste ist der Verlust von Nervenzellen, auch Neurodegeneration genannt. Nervenzellen werden im Laufe der Zeit zunehmend empfindlich, weshalb das Alter einen bedeutenden Risikofaktor für Demenz darstellt.
Zumindest bei der Alzheimer-Krankheit hat man eine gute Vorstellung davon, warum das geschieht: Normalerweise werden Eiweiße im Gehirn und im Körper abgebaut. Funktioniert dieser Abbau nicht richtig, neigen die Eiweiße dazu, zu verklumpen und Ablagerungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Zellen zu bilden. Diese Ablagerungen führen dazu, dass die Nervenzellen an Robustheit verlieren und letztlich absterben.
Die zweite Ursache sind Gefäßveränderungen, also die Durchblutung. Ab einem bestimmten Alter sind bei vielen Menschen die kleinen Gefäße nicht mehr in Ordnung, was die Pathologie verstärken kann. Rein gefäßbedingte Erkrankungen, die zur Demenz führen, machen jedoch nur etwa fünf bis zehn Prozent der Fälle aus.
Dank großer Fortschritte in der Demenzdiagnostik können wir die Veränderungen, die unter dem Begriff Biomarker zusammengefasst werden, mittlerweile gut nachweisen. In der Bildgebung können wir Zelluntergänge, sogenannte Atrophien, in bestimmten Gehirnregionen erkennen. Auch falsch gefaltete Eiweiße und Gefäßveränderungen lassen sich in der Hirnflüssigkeit und durch Computerscans nachweisen.
Was ist der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer?
Josef Marksteiner: Demenz ist der Oberbegriff. Es gibt an die 100 Ursachen, die zur Demenz führen – in 50 bis 60 Prozent der Fälle ist es die Alzheimer-Krankheit, weshalb die Begriffe manchmal gleichgesetzt werden.
Wie verläuft eine Demenzerkrankung im Regelfall?
Josef Marksteiner: Die Erkrankung ist fortschreitend und verläuft in verschiedenen Stadien, die von leicht bis schwer reichen. Wie schnell das passiert, ist individuell und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Auch die Dauer ist schwer vorauszusagen. Studien zeigen, dass die Zeitspanne zwischen der Diagnose und dem Tod zwischen drei und 14 Jahren liegt.
Was sind erste Anzeichen für eine beginnende Demenzerkrankung?
Josef Marksteiner: Vergesslichkeit ist ein häufiges Symptom, aber nicht immer ein Hinweis auf Demenz. Es kommt darauf an, wie oft sie auftritt und ob sie sich im Laufe der letzten Monate verstärkt hat. Wenn man gelegentlich jemanden auf der Straße trifft, dessen Namen man nicht mehr weiß, ist das normal. Wenn das jedoch deutlich häufiger vorkommt als früher, sollte man aufmerksam werden. Auch Schwierigkeiten beim Lesen von komplizierten Texten wie Betriebsanleitungen können ein Hinweis auf eine beginnende Demenzerkrankung sein.

Begeben sich die meisten Betroffenen von selbst in Behandlung?
Josef Marksteiner: Einige nehmen die Veränderungen bei sich selbst wahr und suchen aktiv nach einer Abklärung. Das ist die Gruppe, die sagt: „Das kommt mir eigenartig vor, das möchte ich abklären lassen.“ Diese Menschen sind am einfachsten zu motivieren, da sie selbst die Initiative ergreifen.
Dann gibt es die Gruppe, die auf Drängen von Angehörigen zur Abklärung kommt. Hier ist es oft schwieriger, da die Motivation nicht von der Person selbst ausgeht. Es erfordert mehr Überzeugungsarbeit und Einfühlungsvermögen, um diese Menschen zur Mitarbeit zu bewegen.
Die schwierigste Gruppe sind diejenigen, die ihre Symptome verdrängen und nicht wahrhaben wollen, dass etwas nicht stimmt. Diese Verdrängung nennt man Anosognosie. Die Betroffenen wollen von ihrer Erkrankung gar nichts wissen und nehmen sie nicht richtig wahr. Mit ihnen umzugehen, ist eine besondere Herausforderung, da sie die Notwendigkeit einer Abklärung nicht erkennen.
Wie geht man damit um, wenn ein:e Betroffene:r die Erkrankung nicht wahrnehmen möchte?
Josef Marksteiner: Ich würde nicht empfehlen, die Person direkt mit Vorwürfen oder Bevormundung zu konfrontieren – im Sinne von: „Du siehst doch, wie viele Fehler dir passen und was alles nicht mehr geht.“ Manchmal ist der indirekte Weg besser, etwa über den Besuch bei dem:der Hausärzt:in. Hier kann man zunächst eine körperliche Abklärung einleiten, vielleicht eine Blutuntersuchung oder ein EKG, ins Gespräch kommen und das Ganze Schritt für Schritt angehen.
Steht die Diagnose schließlich fest, ist die Angst vor dem, was kommt, oft groß. Wie wirkt sich die Demenzerkrankung auf das tägliche Leben aus?
Josef Marksteiner: Sie greift sehr tief in das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen ein. Wie stark, hängt dabei natürlich vom Schweregrad der Krankheit ab. Es gibt oft typische Entwicklungen: Der Kreis der Bekannten und Menschen, die die demenzkranke Person umgeben, wird immer kleiner. Häufig erleben wir dann, dass es am Ende nur noch eine Person gibt, die akzeptiert wird und sich kümmert.
Das führt dazu, dass diese eine Person massiv überfordert ist, emotional wie auch physisch, weil viele unterschiedliche Belastungen auftreten können. Deshalb ist es so wichtig, möglichst früh einen großen Unterstützer:innenkreis aufzubauen und auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn die Tendenz der Betroffenen ist leider, sich immer weiter zurückzuziehen, da soziale Kontakte abnehmen und die Kommunikation zunehmend schwieriger wird.
Verena Bramböck: Ich denke, es ist wichtig, individuell zu betrachten, wo die demenzerkrankte Person und ihre Familie gerade stehen. Man muss bedürfnisorientiert vorgehen und die jeweilige Situation genau analysieren, um dann gezielt die passende Unterstützung anbieten zu können.
Wir wissen aus Erfahrung, dass eine schnelle und individuell abgestimmte Unterstützung nach der Diagnosestellung positive Auswirkungen auf den Verlauf der Erkrankung haben kann. Fehlt diese jedoch über einen längeren Zeitraum, besteht die Gefahr, dass sich negative Szenarien und Ängste im Kopf festsetzen, die sich wiederum ungünstig auf den Krankheitsverlauf auswirken können.
Ein offener Umgang mit der Demenzerkrankung ist wichtig, auch nach außen.
Verena Bramböck, Koordinationsstelle Demenz Tirol
Josef Marksteiner: Auf der anderen Seite stehen wir vor der Herausforderung, dass viele Menschen heutzutage alleine leben. Die Vorstellung, dass alle in Großfamilien zusammenleben und es automatisch jemanden gibt, der sich kümmert und unterstützt, entspricht immer weniger der Realität.
Wir erleben auch im Krankenhaus immer wieder, dass Patient:innen aufgrund anderer Ursachen wie einer Lungenentzündung aufgenommen werden, und man dann eine Demenzerkrankung feststellt, wo man sich fragt, wie sie es bisher überhaupt geschafft haben, alleine zu leben. Die zunehmende Vereinsamung ist in diesem Zusammenhang ein großes Thema.

Müsste man alleinstehenden Menschen demnach besondere Aufmerksamkeit schenken?
Josef Marksteiner: Ja, hier wäre es wichtig, die Einbindung in soziale Kontakte frühzeitig sicherzustellen. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Ich denke, das ist eine der großen Herausforderungen, vor der wir stehen, zumal die Welt um uns herum immer komplexer wird. Gleichzeitig wird es für Menschen mit Demenz immer schwieriger, sich schon zu Beginn der Erkrankung zurechtzufinden.
Wenn man in einer überschaubaren Umgebung lebt, wo Wege klar sind, ist das sicher einfacher. In einer Stadt, in der Abläufe oft komplex sind, ist es viel schwieriger. Demenz ist daher nicht nur eine medizinische, sondern immer auch eine soziale Frage, denn die Erkrankung greift massiv in das soziale Leben ein.
Wir müssen uns auch von der Vorstellung verabschieden, dass es bei einer Alzheimer-Diagnose eine einheitliche Ausprägung gibt. Selbst wenn zwei Personen dieselbe Diagnose haben, sind die Verläufe oft sehr unterschiedlich, obwohl es gemeinsame Merkmale gibt, die die Krankheit definieren. Die Menschen dahinter bleiben aber eigenständige Persönlichkeiten. Es gibt zum Beispiel Betroffene, die in einem Heim gut zurechtkommen und Anschluss finden, während andere, mit der gleichen Diagnose und dem gleichen Schweregrad, gar nicht damit zurechtkommen. Man darf Menschen also nicht nur auf ihre Diagnose reduzieren, denn sie sind weit mehr als das.
Es ist wichtig, möglichst früh ein großes Netzwerk an Unterstützer:innen aufzubauen.
Josef Marksteiner, Psychiater
Wie sehen die konkreten Therapiemöglichkeiten aus?
Josef Marksteiner: Demenz kann zwar nicht geheilt, aber verzögert werden. Insbesondere für die Alzheimer-Krankheit gibt es verschiedene Möglichkeiten der medikamentösen Behandlung, die die Gedächtnisleistung unterstützen und den Abbau der Nervenzellen verzögern können. Eine neue, vielversprechende Möglichkeit ist die Therapie mit sogenannten Amyloid-Antikörpern, welche die Eiweißablagerungen im Gehirn auflösen – diese Therapie ist in Europa allerdings bislang nicht zugelassen. Ich hoffe, dass sich das bald ändern wird. Mit der richtigen Behandlung kann es demenzerkrankten Menschen ermöglicht werden, länger autonom zu leben.
Je früher man damit beginnt, desto besser. Denn der Beginn der Erkrankung ist nicht der Zeitpunkt der Diagnose, sondern möglicherweise schon viel früher. Nur ist der Mensch lange imstande, das zu kompensieren. Die Veränderungen im Gehirn können über zehn oder 15 Jahre hinweg stattfinden, bevor die Diagnose gestellt wird. Deshalb spielt auch die Prävention von Risikofaktoren eine Rolle – würden wir diese optimal behandeln und eindämmen, könnten wir fast 40 Prozent der Demenzerkrankungen verhindern.
Was sind die Risikofaktoren?
Josef Marksteiner: Zu jenen, die wir über einen längeren Zeitraum beeinflussen können, zählen beispielsweise Bluthochdruck, der Cholesterinspiegel, Depressionen und sensorische Deprivation, also ein schlechteres Seh- und Hörvermögen. Aber auch die Häufigkeit der sozialen Kontakte und Einsamkeit spielen eine Rolle.
Welchen Rat haben Sie für Angehörige, was den Umgang mit demenzerkrankten Personen betrifft?
Verena Bramböck: Die Bedeutung des Gesprächs sollte nicht unterschätzt werden. Wir haben gelernt, wie wichtig es ist, so lange wie möglich im Austausch zu bleiben. Unser Ziel ist es daher, die Betroffenen möglichst früh zu erreichen. Auch wenn eine Diagnose bereits gestellt ist, kann man nämlich zu Beginn der Erkrankung noch gut gemeinsam mit Angehörigen darüber sprechen, wie sich die betroffene Person die Betreuung im späteren Verlauf wünscht.
Solche frühzeitigen Absprachen erleichtern später viele Entscheidungen, auch wenn die Person dann vielleicht anders reagiert – es gibt mir als Angehörige zumindest eine Orientierung, an der ich mich festhalten kann. Das ist oft harte Arbeit, und manchmal hilft es, wenn professionelle Unterstützung dabei ist. Offenheit ist dabei wichtig, auch nach außen – sie hilft in den meisten Fällen, die Situation zu entlasten und sie besser zu bewältigen. Es verursacht viel Druck, wenn Familien versuchen, die Situation zu verstecken oder zu verschweigen, damit es die Nachbar:innen nicht mitbekommen.
Welche Unterstützungsmöglichkeiten und Ressourcen stehen Betroffenen und ihren Angehörigen zur Verfügung?
Verena Bramböck: Es kann bedrohlich sein zu merken, dass die eigenen Fähigkeiten, Wünsche und Träume sich sukzessive verändern oder man sich nicht mehr daran erinnern kann. Der Austausch und der gemeinsame Fokus auf die vorhandenen Ressourcen können dabei helfen, die Selbstständigkeit und den Selbstwert zu bewahren.
Aber auch für Angehörige ist es wichtig, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Sie stehen oft vor großen Herausforderungen und benötigen Hilfe, um die Belastung zu bewältigen. Dafür gibt es spezielle Beratungs- und Austauschangebote für Angehörige. Wie Professor Marksteiner schon gesagt hat, sollte die Betreuung von Menschen mit Demenz nicht nur auf einer Hauptbetreuungsperson lasten, sondern auf mehreren Schultern verteilt werden – deshalb braucht es ein Netzwerk. So können wir dafür sorgen, dass Menschen mit Demenz ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben führen.
Das könnte dich auch interessieren:
- Warum wir über das Thema Fehlgeburten sprechen sollten
- Die Angst vor Veränderung – und wie wir damit umgehen lernen
- Schwere Last: Warum Schlanksein ein Privileg ist
Mehr über die Autorin dieses Beitrags:

Andrea Lichtfuss ist Stv. Chefredakteurin der TIROLERIN und für die Ressorts Beauty, Style und Gesundheit zuständig. Sie mag Parfums, Dackel und Fantasyromane. In ihrer Freizeit findet man sie vor der X-Box, beim Pub-Quiz oder im Drogeriemarkt.